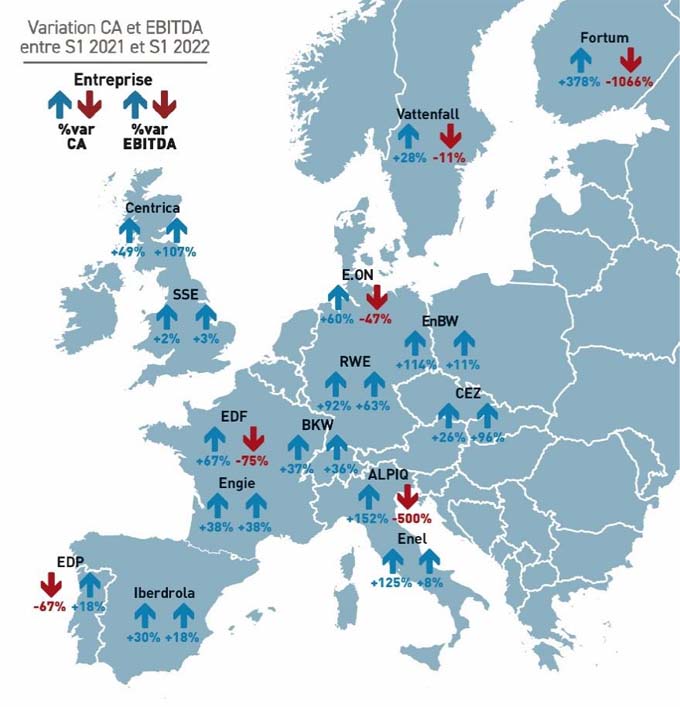Was bedeutet eigentlich… «Prompt»?
Unsere Branche ist ja an sich bekannt dafür, prompt etwas zu adaptieren, wenn es erfolgsversprechend scheint. Und prompt im Sinne von unverzüglich, unmittelbar (als Reaktion auf etwas) erfolgend. Deshalb wundert nicht, dass AI oder KI das grosse Thema in der Branche geworden ist. Kunden lassen sich zu Aussagen hinreissen wie «jetzt brauchen wir endlich keine […]
 Unsere Branche ist ja an sich bekannt dafür, prompt etwas zu adaptieren, wenn es erfolgsversprechend scheint. Und prompt im Sinne von unverzüglich, unmittelbar (als Reaktion auf etwas) erfolgend. Deshalb wundert nicht, dass AI oder KI das grosse Thema in der Branche geworden ist. Kunden lassen sich zu Aussagen hinreissen wie «jetzt brauchen wir endlich keine Agentur mehr» und Agenturen zu «Agentur XY setzt für Kunde Z auf KI». Die gemeinen Mitarbeitenden schwanken dabei zwischen trotzigem, panischem und begeistertem Verhalten den neuen Arbeitsinstrumenten gegenüber. Sie fragen sich: Müssen wir uns um unsere Jobs sorgen? Jein, denn die AI/KI-Tools schaffen auch neue Jobs. Zum Beispiel die Prompt Engineers. Womit wir bei der zweiten Deutung des Wortes sind. Aber eins nach dem andern.
Unsere Branche ist ja an sich bekannt dafür, prompt etwas zu adaptieren, wenn es erfolgsversprechend scheint. Und prompt im Sinne von unverzüglich, unmittelbar (als Reaktion auf etwas) erfolgend. Deshalb wundert nicht, dass AI oder KI das grosse Thema in der Branche geworden ist. Kunden lassen sich zu Aussagen hinreissen wie «jetzt brauchen wir endlich keine Agentur mehr» und Agenturen zu «Agentur XY setzt für Kunde Z auf KI». Die gemeinen Mitarbeitenden schwanken dabei zwischen trotzigem, panischem und begeistertem Verhalten den neuen Arbeitsinstrumenten gegenüber. Sie fragen sich: Müssen wir uns um unsere Jobs sorgen? Jein, denn die AI/KI-Tools schaffen auch neue Jobs. Zum Beispiel die Prompt Engineers. Womit wir bei der zweiten Deutung des Wortes sind. Aber eins nach dem andern.
Mit dem preisgekrönten Artikel über künstliche Intelligenz von Reto U. Schneider im NZZ Folio von letztem September hatten OpenAI, ChatGPT und ihre Geschwister ein erstes Mal eine grössere Bühne im deutschsprachigen Raum. AI- und KI-Tools sind seither in den Medien und in Agenturen und Marketing- und Kommunikationsabteilungen von Unternehmen allgegenwärtig.
Zur Erinnerung, wie an dieser Stelle schon einmal erläutert: Das A steht für «Artificial», das I für «Intelligence» und ausgesprochen wird es «Ai-Ei». Der kleine Bruder der Abkürzung heisst KI, wird Deutsch ausgesprochen «Ka-I» und steht für «Künstliche Intelligenz». Wer aber «Kei-Ei» sagt (und das sind nicht wenige), outet sich definitiv als unwissender Nachplapperi und muss sich tatsächlich um seinen Job sorgen. Denn nachplappern ist eigentlich genau das, was nun die AI/KI-Tools wie ChatGPT, Quilbot, Surfer SEO, Murf, Fireflies, Scalenot, Textplaze und wie sie alle heissen, machen. Und zwar besser, schneller und günstiger. Vor allem wenn man sie richtig füttert.
Shit in Shit out
Jede Person, die sich schon mal mit statistischen Daten befasst hat, weiss: Das Resultat der Daten ist immer nur so gut wie die Aufgabenstellung, mit der sie gefüttert werden. Oder kurz: Shit in Shit out. Damit also AI/KI-Tools texten, recherchieren, malen oder filmen können, brauchen sie eine Aufgabe, die clever formuliert ist. Und genau das ist prompt. In Englisch bedeutet das Wort nämlich Stichwort, Abfrage oder noch deutscher: Eingabeaufforderung.
Wir kennen das von Google: Je intelligenter nach etwas gesucht wird, desto besser die Suchresultate (wenn man sich dann erst durch die bezahlten Resultate gescrollt hat, die leider – so phantasielos wie SEA teilweise Worte ersteigert werden – oft sehr wenig mit der Eingabe zu tun haben).
Wer also in den AI/KI-Tools gut promptet, kriegt auch die besten Resultate. Deshalb sind die Diskussionen darüber, wie gut und nützlich diese Tools wären, etwas müssig. Gleich müssig wie die Frage nämlich, wie gut ein Team von richtigen Mitarbeitenden denn tatsächlich ist. Denn auch hier gilt: Wer die Aufgabe nicht präzis formuliert und Mitarbeitende nicht gut führt, kann sich im Nachhinein nicht über Schlechtleistung beklagen. Ein Prompt Engineer muss also ähnlich wie die Vorgesetzten oder Kunden die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen und die Schwächen seiner Agentur, seines Teams oder seiner AI/KI-Tools kennen, um aus ihnen ein brauchbares oder manchmal aussergewöhnliches Resultat herauszulocken. Deshalb, wer gut prompten kann, wird sich kaum über die Fähigkeiten der AI/KI-Tools beschweren. Höchstens umgekehrt, denn die lernen prompt von dem, was wir sie fragen.
* Benno Maggi ist Mitgründer und CEO von Partner & Partner. Er lauscht seit über 30 Jahren in der Branche und entdeckt dabei für uns Worte und Begriffe, die entweder zum Smalltalken, Wichtigtun, Aufregen, Scrabble spielen oder einfach so verwendet werden können.










 In einem zweitägigen Workshop wurde das Illustrations-System implementiert und damit die Designer:innen geschult, damit sie das System selbständig anwenden können. Die Illustrationen sind u.a. auf der Website, in Katalogen und im Headquarter zu sehen. Die lange Tradition des Unternehmens spiegelt sich auch im umfangreichen Bildmaterial zur Geschichte und Entwicklung von Victorinox wider. Für Sapera Studios war klar: Victorinox braucht einen Stil, der die Marke eindeutig erkennbar macht und zugleich eine Erweiterung und Modernisierung ist.
In einem zweitägigen Workshop wurde das Illustrations-System implementiert und damit die Designer:innen geschult, damit sie das System selbständig anwenden können. Die Illustrationen sind u.a. auf der Website, in Katalogen und im Headquarter zu sehen. Die lange Tradition des Unternehmens spiegelt sich auch im umfangreichen Bildmaterial zur Geschichte und Entwicklung von Victorinox wider. Für Sapera Studios war klar: Victorinox braucht einen Stil, der die Marke eindeutig erkennbar macht und zugleich eine Erweiterung und Modernisierung ist. Basierend auf der vorhandenen Markenidentität wurde ein elegantes Design gestaltet: Icons und Illustrationen mit klaren Linien und präzisen Formen. Illustrationen, z. B. von Menschen, bleiben ohne Details, technische Illustrationen bilden Objekte vereinfacht, genau und klar ab – mit hohem Wiedererkennungswert. Präzise wurde in der Guideline festgehalten, welche Parameter jede Infografik, jedes Icon und jede Illustration ausmachen – und wie dick etwa die Außenlinie ist, welche Farben wann verwendet werden, wie Objekte abstrahiert.
Basierend auf der vorhandenen Markenidentität wurde ein elegantes Design gestaltet: Icons und Illustrationen mit klaren Linien und präzisen Formen. Illustrationen, z. B. von Menschen, bleiben ohne Details, technische Illustrationen bilden Objekte vereinfacht, genau und klar ab – mit hohem Wiedererkennungswert. Präzise wurde in der Guideline festgehalten, welche Parameter jede Infografik, jedes Icon und jede Illustration ausmachen – und wie dick etwa die Außenlinie ist, welche Farben wann verwendet werden, wie Objekte abstrahiert.





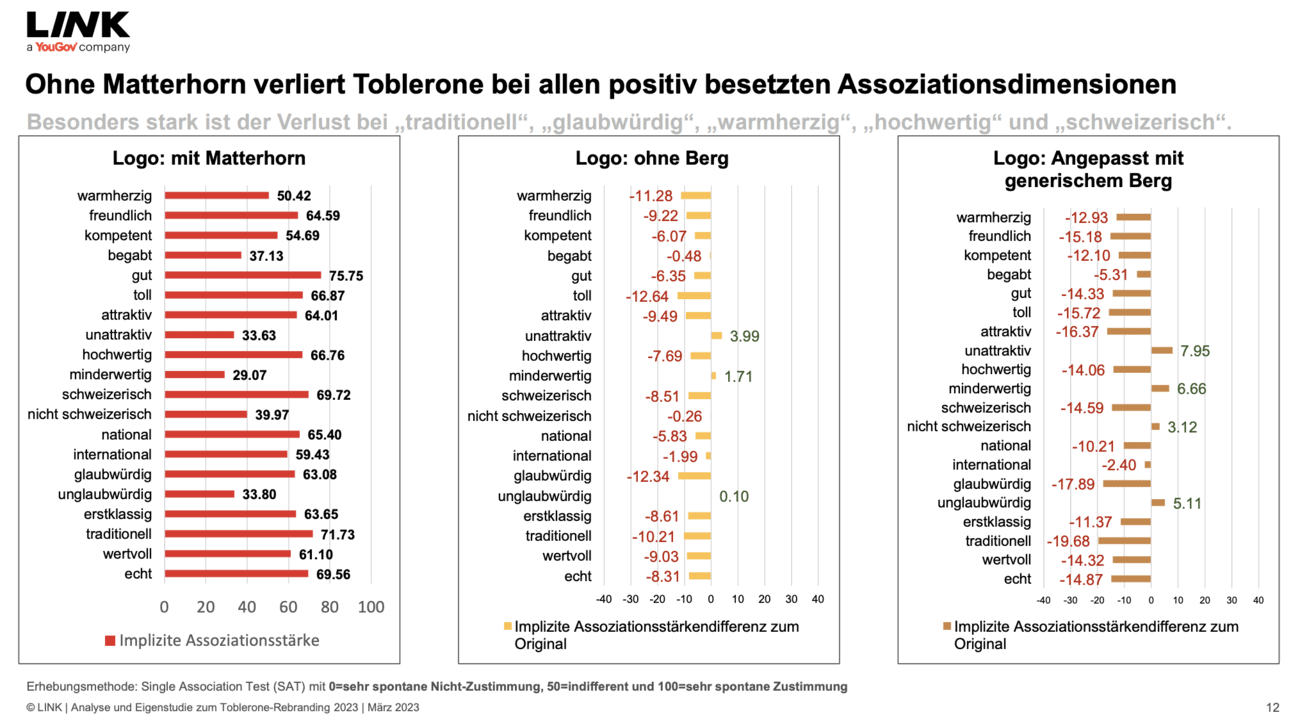

 Zeitliche Entwicklung von Managementstandards, schematische Darstellung (Auswahl). Quellen: Hochschule Zittau/Görlitz, TIMS, SQS.[/caption]
Zeitliche Entwicklung von Managementstandards, schematische Darstellung (Auswahl). Quellen: Hochschule Zittau/Görlitz, TIMS, SQS.[/caption]
 Für Zugreisende, Pendlerinnen und alle anderen Bahnhofbesucher gibt es jetzt eine neue Werbemöglichkeit von Tamas Media: auffällige rote Boxen, die an mehr als 140 Bahnhöfen in der ganzen Schweiz zu finden sind. Insgesamt gibt es 260 Boxen, 220 davon in der Deutschschweiz und 40 in der Romandie. Die Boxen können mit Magazinen, Zeitschriften oder anderen Werbedrucksachen befüllt werden.
Für Zugreisende, Pendlerinnen und alle anderen Bahnhofbesucher gibt es jetzt eine neue Werbemöglichkeit von Tamas Media: auffällige rote Boxen, die an mehr als 140 Bahnhöfen in der ganzen Schweiz zu finden sind. Insgesamt gibt es 260 Boxen, 220 davon in der Deutschschweiz und 40 in der Romandie. Die Boxen können mit Magazinen, Zeitschriften oder anderen Werbedrucksachen befüllt werden.
 Die Schweiz verteidigt ihren Titel als Europameisterin im Retournieren von online bestellten Produkten. Die Internet-Shopper haben letztes Jahr 28 Prozent der Pakete zurück an den Absender geschickt. Die Retouren-Quote steigt weiter, obschon immer mehr Händler eine Kostenpflicht eingeführt haben. Das zeigt der neue E-Shopper Barometer von Geopost, einer regelmässig in über 20 europäischen Ländern durchgeführten Studie.
Die Schweiz verteidigt ihren Titel als Europameisterin im Retournieren von online bestellten Produkten. Die Internet-Shopper haben letztes Jahr 28 Prozent der Pakete zurück an den Absender geschickt. Die Retouren-Quote steigt weiter, obschon immer mehr Händler eine Kostenpflicht eingeführt haben. Das zeigt der neue E-Shopper Barometer von Geopost, einer regelmässig in über 20 europäischen Ländern durchgeführten Studie.