Was bedeutet eigentlich… «Lakehouse»?
Jetzt, wo langsam alle wieder eintrudeln in die Arbeitswelt, nach gefühlt endlosen Sommerferien, könnte man leicht der Verführung nachgeben und das neue Buzzword «Lakehouse» als Ferienerinnerung oder -erzählung abtun – aber Obacht, ist es nicht. Auch wenn Sommerferien in der Schweizer Agentur- und Marketingwelt langsam französische Dimensionen annehmen, wie sie der Autor Frédéric Beigbeder in […]

Jetzt, wo langsam alle wieder eintrudeln in die Arbeitswelt, nach gefühlt endlosen Sommerferien, könnte man leicht der Verführung nachgeben und das neue Buzzword «Lakehouse» als Ferienerinnerung oder -erzählung abtun – aber Obacht, ist es nicht.
Auch wenn Sommerferien in der Schweizer Agentur- und Marketingwelt langsam französische Dimensionen annehmen, wie sie der Autor Frédéric Beigbeder in seinem 2001 erschienenen Roman «99 franc» (Pflichtlektüre für Jung-Werber) so wunderschön sarkastisch beschrieben hatte und gefühlt mittlerweile von Anfang Juli bis Anfang September dauern: Ein Lakehouse kann man nicht auf Airbnb buchen, vielmehr es wird die nächsten Jahre das Marketing (hoffentlich) fundamental verändern.
Wenn Marketing endlich mit Technik zusammenspannen würde
Ein Data Lakehouse ist eine Datenmanagementarchitektur, welche die Vorteile eines herkömmlichen Data Warehouse und eines Data Lake kombiniert. Data Warehouses wurden bereits in den 1980er Jahren als hochleistungsfähige Speicherebenen entwickelt, die sogenannte Business Intelligence (BI) und Analysen unabhängig von einer operativen Transaktionsdatenbank unterstützten. Data Lakes kamen dann in den 0er Jahren in Mode, weil sie eine kostengünstige Speicherebene für unstrukturierte und semistrukturierte Daten waren.
Ein Data Lakehouse bietet nun dank einfachem Zugriff und der Unterstützung für Unternehmensanalysen, die in Data Warehouses zu finden sind, Hilfe, und zwar mit der Flexibilität und den relativ geringen Kosten eines Data Lake. Alles klar?
Wenn nicht, gehören sie zur Mehrheit der Schweizer Marketer. Und das ist genau das Problem, weshalb die Schweiz in Bezug auf Marketingtechnologie (Martech) noch ein Entwicklungsland ist. Schade, denn der richtige Einsatz von Martech bietet nicht nur schier endlose Möglichkeiten, kreativ zu sein, sondern konvertiert ebendiese Kreativität auch zu businessrelevanten Resultaten für die Auftraggeber.
Unserer Branche würde es deshalb guttun, wenn Agenturstrategen, CMOs und CIOs ihre Sommerferien nächstes Jahr vielleicht etwas kürzen und stattdessen gemeinsam über ein Data Lakehouse nachdenken würden. Damit würden vorhandene Technologielösungen endlich auch verstanden werden, was hilft, die Vielzahl von Möglichkeiten für Marketingzwecke zu nutzen: von Plattformen für Digital Asset Management und Marketing-Automatisierung bis hin zu Chatbots und Überwachungstools für Social Media. Die Bewirtschaftung getrennter Systeme wie sie in vielen Unternehmen leider immer noch an der Tagesordnung sind, bedeuten nämlich nicht nur Investitionskosten, sondern auch horrende laufende Betriebskosten auf beiden Seiten, die Administrierung zweier Systeme gar nicht erst mitgerechnet. Und das kann sich schlicht niemand mehr leisten. Ein Lakehouse hingegen schon.
* Benno Maggi ist Mitgründer und CEO von Partner & Partner. Er lauscht seit über 30 Jahren in der Branche und entdeckt dabei für uns Worte und Begriffe, die entweder zum Smalltalken, Wichtigtun, Aufregen, Scrabble spielen oder einfach so verwendet werden können.












 Eine weltweite Umfrage von
Eine weltweite Umfrage von 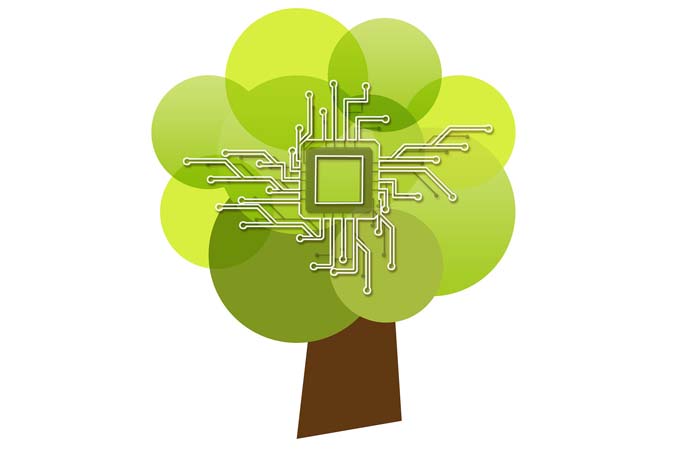




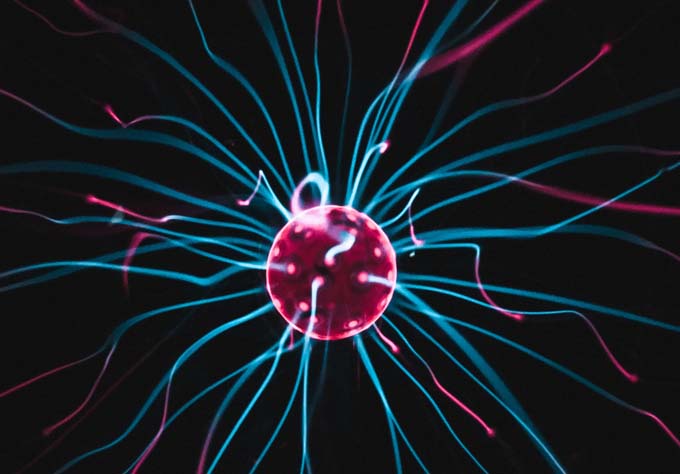

 Das im Juni gestartete Format «Brown Bag Series» von HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Swiss Marketing Forum und AZ Konzept richtet sich an Führungskräfte in Marketing und Kommunikation und soll Fachwissen auf Hochschulniveau mit Praxisbezug vermitteln.
In den letzten Jahren mussten viele Unternehmen feststellen, dass ihre Marketingstrategien nur bedingt für Situationen geeignet sind, in denen sich die Rahmenbedingungen radikal ändern: Pandemie, Krieg, Probleme in den Lieferketten – kaum ein Unternehmen war auf diese Herausforderungen wirklich vorbereitet.
Gleichzeitig erwarten Kundinnen und Kunden, dass Unternehmen ihre Leistungsversprechen einhalten, Haltung zeigen gegenüber den politischen und wirtschaftlichen Themen und auch noch mit Innovationen ihre Leistungen optimieren.
Im Talk wird diskultiert, wie Marketingstrategien besser auf unsichere Zeiten ausgerichtet werden können und wie auch in diesem Umfeld nachhaltiges Wachstum und Innovation möglich werden.
Moderatorin ist Esther-Mirjam de Boer, CEO und Owner von GetDiversity. Teilnehmende des Panels sind Tanja Herrmann, Geschäftsführerin der Influencer- und Social Media Marketing Beratungsagentur WebStages, Cécile Moser, Head of Marketing & Communication bei Jelmoli und Tobias Thut, Leiter Marketing & Verkauf, Mitglied der Geschäftsleitung der Pilatus-Bahnen.
Das im Juni gestartete Format «Brown Bag Series» von HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Swiss Marketing Forum und AZ Konzept richtet sich an Führungskräfte in Marketing und Kommunikation und soll Fachwissen auf Hochschulniveau mit Praxisbezug vermitteln.
In den letzten Jahren mussten viele Unternehmen feststellen, dass ihre Marketingstrategien nur bedingt für Situationen geeignet sind, in denen sich die Rahmenbedingungen radikal ändern: Pandemie, Krieg, Probleme in den Lieferketten – kaum ein Unternehmen war auf diese Herausforderungen wirklich vorbereitet.
Gleichzeitig erwarten Kundinnen und Kunden, dass Unternehmen ihre Leistungsversprechen einhalten, Haltung zeigen gegenüber den politischen und wirtschaftlichen Themen und auch noch mit Innovationen ihre Leistungen optimieren.
Im Talk wird diskultiert, wie Marketingstrategien besser auf unsichere Zeiten ausgerichtet werden können und wie auch in diesem Umfeld nachhaltiges Wachstum und Innovation möglich werden.
Moderatorin ist Esther-Mirjam de Boer, CEO und Owner von GetDiversity. Teilnehmende des Panels sind Tanja Herrmann, Geschäftsführerin der Influencer- und Social Media Marketing Beratungsagentur WebStages, Cécile Moser, Head of Marketing & Communication bei Jelmoli und Tobias Thut, Leiter Marketing & Verkauf, Mitglied der Geschäftsleitung der Pilatus-Bahnen.